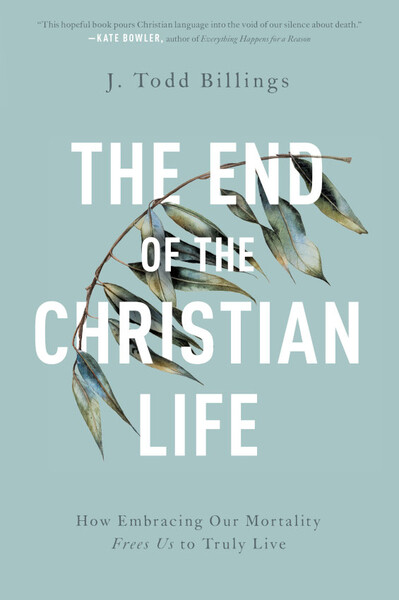
The End of the Christian Life
In dem Film Die Matrix gibt es eine Szene, in der Cypher mit dem Agenten Smith zu Abend isst, kurz bevor er Morpheus und Neo verrät. Dabei sagt er: „Hören Sie, ich weiß, dass dieses Steak nicht existiert. Ich weiß, dass, wenn ich es in meinen Mund stecke, die Matrix meinem Gehirn sagt, dass es saftig ist und ganz köstlich. Nach neun Jahren ist mir eine Sache klar geworden – Unwissenheit ist ein Segen.“
In seinem Buch The End of the Christian Life: How Embracing our Mortality Frees Us to Truly Live (dt. „Das Ende des christlichen Lebens: Wie die Annahme unserer Sterblichkeit uns zum wahren Leben befreit”) fordert Autor J. Todd Billings seine Leser auf, den krampfhaften Versuch aufzugeben, die Wirklichkeit des Todes zu verdrängen und als Christen stattdessen im vollkommenen Licht „des dunklen Todesschattens“ zu leben. Er stellt die These auf, dass die „Wunde des Todes“ uns daran erinnern sollte, „wer wir sind: geliebte und doch kleine, sterbliche Kinder Gottes, die Zeugnis ablegen für den Herrn der Schöpfung, der am letzten Tag alles richten und wiederherstellen wird“ (S. 11).
Billings hat an der Harvard University Divinity School (USA) im Fach Theologie promoviert. Er ist sowohl Professor für Reformierte Theologie am Western Theological Seminary (USA) als auch Krebspatient im Endstadium. Seine theologische Tradition und sein Leben sind eine Bereicherung für das Buch. Die Klarheit und emotionale Tiefe, mit der er schreibt, liegen für mich irgendwo zwischen Über den Schmerz und Über die Trauer von C.S. Lewis. Billings versucht ganz klar, eine theologische Perspektive einzunehmen, nimmt seine Leser aber gleichzeitig mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt, die zum ehrlichen, persönlichen Reflektieren einlädt – über „Schmerz und Freude [...] Verzweiflung und Hoffnung“ (S. 19).
Aus den Tiefen zum Tempel
Das Buch ist eingebettet in Bilder des Alten Testaments, um den Leser auf eine Reise mitzunehmen: von den Tiefen des Scheols (die vermeintliche Abwesenheit des Herrn) hin zum Tempel (die Gegenwart des Herrn). Der Scheol ist „ein tiefes morastiges Loch, jenseits des Lichts [...], ein Ort der Dunkelheit, ein Gefängnis für die Verstummten und vom Leben Abgeschnittenen“ (S. 22). Billings stellt zwar dar, dass der Scheol oft als Grab oder als „Land der Toten und biologisch Verwesten“ (S. 22) interpretiert wird, aber er zeigt auch auf, dass viele, die im Scheol sind, nicht wirklich tot sind (vgl. S. 23–27). Der Tod ist eine Wirklichkeit, die uns allen bevorsteht und jeder, der den Mut hat die Augen aufzumachen, wird sich im Scheol wiederfinden.
Billings verwendet diese Bilder, um die neutestamentliche Realität auf den Punkt zu bringen, die in Martin Luthers berühmter Formel simul justus et peccator (Christen sind gerecht und Sünder zugleich) zusammengefasst ist. Anders ausgedrückt: In Christus sind wir von der Strafe der Sünde befreit, aber nicht von ihrer Gegenwart. Der Lohn der Sünde ist immer noch der Tod, selbst für Christen (vgl. Röm 6,23). Es kann erschreckend sein, wenn uns die Realität des Abgrundes in und um uns herum vor Augen geführt wird. Und „als Tote stellen wir fest, dass wir uns nicht selbst erlösen können“ (S. 47). In Christus aber können wir mit der Zuversicht durch das Tal des Todesschattens hindurchgehen, dass unser Erlöser mit uns ist (vgl. Ps 23,4).
Billings fragt danach, warum manche „alt und lebenssatt“ sterben, während andere „an einer unerwarteten Krankheit [zugrunde gehen], die reißende Ströme der Hoffnung so schnell zum Versiegen bringt“ (S. 61). Seine Schlussfolgerung: „Diese Fragen, auf die wir keine Antworten finden, weisen uns darauf hin, dass wir jemanden brauchen, der uns vorangeht, einen Priester, der unsere Schwachheit kennt, einen Retter, der selbst im Scheol war“ (S. 63).
Eine Gesellschaft von Todesleugnern
Wo es früher die Norm war, dass man Friedhöfe am Weg zum Kircheneingang gelegen fand, ist das heutzutage leider kaum noch der Fall. Dadurch werden Gottesdienstbesucher, die zur Kirche kommen oder sie verlassen, nicht mehr automatisch damit konfrontiert, dass sie vor ihrem Schöpfer nur Staub sind. Stattdessen haben wir die Toten aus unseren Augen verbannt. Entgegen der Weisheit, die wir im Buch Prediger finden (vgl. Pred 7,2), haben wir entschieden, dass es unangenehm ist, den Tod immer vor Augen zu haben.
„Wir können nur wahrhaftig Mensch sein, wenn wir uns selbst ‚in Bezug zu dem Übernatürlichen setzen‘.“
Den Tod zu verleugnen ist letztlich eine Vermeidungsstrategie, die„die Gesellschaft am Laufen hält“ (S. 80) – Christen sind hierbei maßgeblich beteiligt. Wir können nur wahrhaftig Mensch sein, wenn wir uns selbst „in Bezug zu dem Übernatürlichen setzen“ (S. 81). Leider neigen wir Menschen dazu, „unser Handeln als den Mittelpunkt der Weltgeschehnisse zu betrachten“ (S. 88–89) anstatt Gott selbst. Weil wir uns davor scheuen, unsere Sterblichkeit vollends zu akzeptieren, setzen wir unsere Hoffnung auf „Helden“ und ihre Versprechen – und schaffen uns Götzen (vgl. S. 89–92).
Die Fähigkeit, selig zu sterben
Don Carson erzählte mal die Geschichte von einem Gebetstreffen, wo immer und immer wieder um übernatürliche Heilung für eine Frau gebetet wurde – bis seine Ehefrau Gott darum bat, er möge der Frau den Glauben schenken, um selig sterben zu können. Billings untersucht die uralte christliche ars moriendi (die Kunst des Sterbens) und warum wir heute so schlecht darin sind (vgl. S. 113–120).
Seine Schlussfolgerung ist, dass das amerikanische Wohlstandsevangelium sich in unser Unterbewusstsein eingeschlichen hat. Wir „gehen davon aus, dass Gott nur auf eine Weise handelt – indem er heilt und erweckt“ (S. 129). Dementsprechend setzen sich Patienten ausgiebig mit Behandlungsmöglichkeiten auseinander. Immer und immer wieder werden Entscheidungen von Patienten auf der theologischen Basis getroffen, dass Gott nur das Beste für sie im Sinn hat – und das beinhaltet nie den Tod. Aber wie Billings richtig sagt: Die Frage ist „nicht, ob Gott heilt oder Wunder tut [...]. Das Problem ist, dass der Gott der Schrift niemals [diese Art von Wohlergehen] verspricht“ (S. 138).
„Die Spannung des christlichen Lebens wird nie aufgehoben, im Gegenteil, sie wird ans Licht gebracht und angenommen.“
Billings konfrontiert die Leser mit der Frage, die Jesus Martha stellte: Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin (vgl. Joh 1,25–26)? Ob durch allgemeine Gnade oder Wunder – wir erwarten, dass Gott uns jetzt beschenkt. Aber das ist nicht das, was er uns versprochen hat. Stattdessen muss unser einziger Trost im Leben und im Sterben in dem gegründet sein, der die Auferstehung in Person ist – in dem, der durch Leiden vollendet wurde (vgl. Hebr 2,10).
Gebrechliche Menschen sind großartige Tempel
Wenn wir über die unermessliche Kraft unseres Gottes staunen, werden wir mit unserer eigenen Ohnmacht und Gebrechlichkeit als seine Geschöpfe konfrontiert. Aber wie Paulus sagt: In unserer Schwachheit kommt Gottes Kraft am deutlichsten zur Geltung (vgl. 2Kor 12,8–10). Billings erinnert uns daran, dass wir klein sind und lernen müssen, auch so zu leben (vgl. S. 215). Wir, Gottes Volk, sind aus dem Scheol herausgezogen worden, weil unser Erlöser, Jesus Christus, für uns dort hinabgestiegen ist.
Und nun „gebraucht Christus, der König, zerfallende, sterbliche Tempel als den Ort, an dem er mit seiner ganzen Fülle wohnen möchte“ (S. 199). Die Spannung des christlichen Lebens wird nie aufgehoben, im Gegenteil, sie wird ans Licht gebracht und angenommen. Im völligen Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit kann der Leser durch seine Verbindung mit Christus „am gewaltigen, brausenden Klang der himmlischen Chöre teilhaben“ (S. 207), schon jetzt, während er durch den dunklen Todesschatten hinkt.
Buch
J. Todd Billings, The End of the Christian Life: How Embracing Our Mortality Frees Us to Truly Live, Brazos Press, 2020, 240 Seiten, ca. 18,00 Euro.